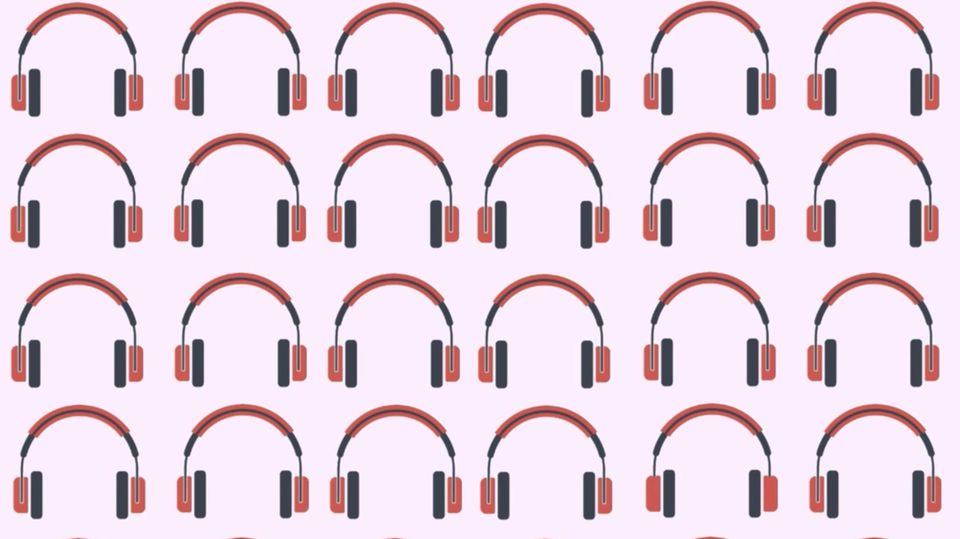Gelegentlich fühlen wir uns bei aller Liebe merkwürdig fremd in Großbritannien. Es kann vielleicht daran liegen, dass wir – streng genommen – auch nur Fremde hier sind. Oder Gäste. Gäste hört sich besser an als Fremde. Seit der Wahl vor ein paar Wochen nimmt dieses Gefühl irgendwie zu. Es hat nichts mit den normalen Menschen zu tun. Es ist vielmehr das, was abstrahlt aus der Politik und dann multipliziert wird in den Zeitungen, im Radio und im Fernsehen.
Gerade zum Beispiel inspizierten der Premierminister David Cameron und seine Innenministerin Theresa May eine Polizei-Aktion, bei der illegale Immigranten hochgenommen wurden. Sie spazierten durch den Londoner Süden und sahen den Beamten bei ihrer Arbeit zu. Auf einem Foto sieht man, wie ein Rumäne in Handschellen abgeführt wird. Auf einem anderen stehen Cameron und May in einer nun leeren Wohnung und smalltalken mit Beamten, die soeben ein paar arme Typen hops genommen haben. Es hatte etwas von Zoobesuch. Man stelle sich das in Deutschland vor: Merkel und de Maizière bei einer Razzia und danach beim freundlichen Geplauder mit den Einsatzkräften. Hier gab es nicht mal den Ansatz von Empörung.
Das sind genau jene Momente, in denen wir uns in Großbritannien europäischer fühlen als wir uns in Deutschland europäisch gefühlt haben. In Deutschland fällt das sich-europäisch-fühlen nicht weiter auf. Es gehört irgendwie zur DNA oder ist gelernt.
Hier fällt es auf. Europa gehört nicht zur DNA – sieht man einmal davon ab, dass Briten bis zu 40 Prozent normannisches oder teutonisches Erbgut in sich tragen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das ewige britische Gemecker beginnt Resteuropa zu nerven
Unsere englischen Freunde wundern sich, warum wir uns überhaupt wundern über die Briten und ihr Verhältnis zum Kontinent. Und wir würden uns nicht mehr wundern, wenn sie dann doch für einen Austritt aus der EU votieren würden. Die Umfragen sprechen zwar dagegen, aber die Umfragen sprachen auch gegen David Cameron, und nun ist er wieder Premier und verspricht seinen Landsleuten, dass er Europa reformieren werde und guckt der Polizei zu, wie sie Immigranten abführt, und die hiesigen Medien trompeten fleißig mit. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich „Dann geht doch!“ denke. Drei Viertel der Deutschen würden ihnen keine Träne nachweinen. Das ist traurig. Irgendwie nervt die Kontinental-Europäer offenbar dieses ständige Gejammer und Gegreine und das Verlangen nach Extrawürsten. Selbst wenn die im Einzelfall sogar berechtigt sind.
Die hiesigen Ökonomen und Finanzexperten wissen natürlich, dass Großbritannien mehr auf die EU angewiesen ist als umgekehrt die EU auf Großbritannien. Ein EU-Austritt wäre wirtschaftlicher Suizid. Denn die britische Wirtschaft ist in Wahrheit nur noch eine Monokultur und abhängig vom Finanzplatz London. Die Banken warnen mehr oder weniger einhellig vor dem Brexit. Und das, was an Handel bleibt, ist dann auch noch EU-dominiert: Sieben der zehn britischen Top-Handelspartner liegen auf dem Festland, 45 Prozent aller Exporte gehen nach Europa. Obendrein würde ein EU-Austritt mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit die EU-freundlichen Schotten in ein weiteres Referendum treiben und, nach Stand der Dinge, diesmal wirklich raus aus der Union, womit Großbritannien dann endgültig Kleinbritannien wäre. Eine Insel von überschaubarer Größe in der Nordsee. Etwas größer als Irland und nur eine Terz bedeutender. Eigentlich sprechen alle Argumente für Europa. Eigentlich.
Im Wahlkampf wirkte das Königreich so, wie es irgendwie auch ist. Selbstzentriert, insular, man könnte fast sagen: provinziell. Europa spielte im Wahlkampf keine Rolle. Jetzt schon. Jetzt melden sich konservative Hinterbänkler und verlangen von Cameron, er solle die Europäer zu möglichst vielen Zugeständnissen zwingen. Nun sind diese Hinterbänkler eben auch nur Hinterbänkler und interessieren in Berlin oder in Paris oder Den Haag oder Warschau völlig zu Recht auch niemanden. Der konservative Europafreund Ken Clarke nennt sie die „Ahnungslosen“ oder auch „Knalltüten“. Es gibt sogar Hinterbänkler hier, die Minister sein dürfen. Der Minister für Europa heißt David Lidington, ist so einer und dafür berüchtigt, noch nie etwas wirklich Essentielles über Europa gesagt zu haben. Wäre er nicht Minister für Europa, wäre er wohl Hinterbänkler. Das sagt auch einiges aus über den Stellenwert von Europa. Vergangene Woche hielt er ein Briefing im Außenministerium. Der Minister federte gut gelaunt in den Raum, trommelte auf ein paar lindgrünen Seiten herum und sprach: „Hier ist es: der Gesetzentwurf zum Referendum“. Das war sein bester Satz.
Und was passiert mit den Briten, die auf dem Kontinent leben?
Eine spanische Journalistin fragte ihn, ob sich die Regierung schon mal damit befasst habe, dass es mehr britische Sozialhilfe-Empfänger auf dem europäischen Festland gäbe als umgekehrt. Und warum sich offenbar niemand darum schere, dass zirka eine Million Briten in Spanien leben und ein EU-Austritt für die ziemlich blöd sein könnte. Überhaupt wären Briten auf dem Kontinent bei einem EU-Austritt auch allesamt „illegal immigrants“ und müssten sich mühsam um eine Aufenthaltsgenehmigung bemühen.
So wie wir dann hier.
Lidington ging darauf nicht weiter ein und hielt statt dessen ein reichlich überflüssiges Referat über Europa nach dem Krieg. Er wurde auch gefragt, was sich genau die Briten wünschen von Europa, und darauf sagte er, dass könne man doch alles nachlesen in Reden von David Cameron und im Parteimanifest. Aber in den Reden von Cameron steht das auch nicht. Was die Briten wirklich wollen an Reformen bleibt merkwürdig nebulös. „Treaty change“ einerseits, aber dann auch wieder nicht so richtig. Weniger Bürokratie und noch weniger Wohlfahrtstourismus, mehr Rechte für die nationalen Parlamente. Insgesamt: weniger Europa. Nach einer halben Stunde musste Lidington dann gehen. Es war wie in der satirischen Fernsehshow „Yes, Minister“. Er hatte nicht eine Frage zufriedenstellend beantwortet.
In der Schule blieben die lauten Hinterbänkler meistens sitzen
Ein paar Tage später erlebte man dann den Gegenentwurf. Von einem Deutschen. Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, war in London. Er redete Tacheles und zwar erst mal mit englischen Journalisten, denen er klar sagte, was ihnen die eigenen Politiker nie so klar sagen: Es wird nichts mit Treaty change. Zumindest nicht so schnell. Er sprach von einer politischen „Rhetorik des Leidens“ auf der Insel und fragte sich, wie sehr die Briten wirklich unter Europa leiden. Sie sollten außerdem irgendwann mal definieren, wann sie „genug weniger Europa“ für erreicht hielten und dass die europäische Idee stärker sei als ewige Debatten über sie. Für einen Mann in diplomatischer Mission war er erfrischend ehrlich und eine Art Lidington-Antipode. Fast hätte es Applaus gegeben.
Solche Töne hört man nämlich selten hier. Man hört eher die Lauten auf den hinteren Bänken, die johlen und schimpfen und fordern. Es ist ein bisschen wie früher in der Schule. Auf den Bänken hinten saßen oft die lauten Chaoten, die - zugegeben – zur Freude aller die Lehrer nervten.
Allerdings war es in der Schule auch so: Am Ende des Jahres blieben die lauten Chaoten meistens sitzen.